In ihrem Artikel »Bitte schafft die Werkstätten nicht ab« hält Cornelia Schmitz (AlexOffice) ein „Plädoyer für eine gefährdete Spezies“ und ruft aus Sicht der Menschen mit Behinderungen zu echter Gleichberechtigung und zu entsprechenden Rahmenbedingungen auf.
»Bitte schafft die Werkstätten nicht ab«
Ein Plädoyer für eine gefährdete Spezies
Die Werkstätten für behinderte Menschen sind umstritten. Sie sind in schlechten Ruf geraten. Überaus kritische Stimmen werden laut. Es umweht die Werkstätten der Dunst von „Sondereinrichtungen“, von „Absonderung“, kurz: von Ausschluss. Sogar von Ausbeutung und Quälereien.
Wir, die behinderten Menschen, könnten jedenfalls nicht vollumfänglich „teilhaben“, und in einer inklusiven Gesellschaft arbeiteten wir nicht in einer Spezialeinrichtung, sondern wären auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden.
Der Streit um Werkstätten geht zurück auf die UN-Behindertenrechtskonvention, ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, welches 2008 in Kraft trat.
In diesem Sinn sollen „alle Menschen von Anfang an in allen gesellschaftlichen Bereichen, selbstbestimmt und gleichberechtigt miteinander leben und allen unabhängig davon, ob sie behindert oder nicht behindert sind, Teilhabe möglich sein (…) Dementsprechend leben, arbeiten und lernen Menschen mit Behinderungen in einer inklusiven Gesellschaft nicht in Sondereinrichtungen (…) Inklusion bedeutet also (…) die Verwirklichung umfassender, gleichberechtigter und selbstbestimmter Teilhabe“. (Aus: „Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“).
Ich bin sehr dafür, dieses schöne Ziel umzusetzen. Allerdings nicht überhastet, unreflektiert und überstürzt wie bereits in Deutschlands Schulen geschehen, sondern langsam, mit Augenmaß, und vor allem unter maßgeblicher Beteiligung der betroffenen Menschen.
Von denen viele, darunter auch ich, die Werkstätten erhalten sehen wollen. Und sie über die Köpfe der darin arbeitenden Menschen abzuschaffen – das wäre wohl das Gegenteil von Inklusion. (Übrigens wurde die gemeinsame Beschulung behinderter und nicht behinderter Kinder damals in der UN-Konvention gar nicht explizit gefordert – sie erschien nur in Deutschland als zentraler Inhalt. Aber das nur am Rand).
In vorausgegangen Beiträgen habe ich schon beschrieben, wie Werkstätten sich wandeln könnten, um dem Ziel der umfassenden Teilhabe gerecht zu werden: xblog.alexianer-werkstaetten.de/werkstatt-weiterdenken
Heute soll es vor allem darum gehen, was ich an (m)einer WfbM bereits gut, richtig, und auf die Bedürfnisse der Teilnehmer im Sinne der Inklusion zugeschnitten finde. Ich schreibe aus der Sicht einer Teilnehmerin mit einer psychischen Erkrankung.
Meine Werkstattgeschichte: Seit 2007 bin ich bei den Alexianer Werkstätten in Köln beschäftigt. Zurzeit arbeite ich im Alex- Office in Ossendorf, das ist eine Designwerkstatt. Dort bin ich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig, schreibe, übersetze (in die leichte Sprache) blogge und podcaste.
In dieser Arbeit gehe ich auf, ich freue mich darüber, und meine Rahmenbedingungen würde sich wohl jeder wünschen: Ich kann in Ruhe, ohne Druck, mit Rücksichtnahme auf meine Bedürfnisse, ohne Zensur authentisch so arbeiten, wie ich will – all das wäre so auf dem ersten Arbeitsmarkt nie, niemals möglich.
Diese Bedingungen gelten für alle Kollegen und Kolleginnen. Wir können uns ausprobieren, neue Dinge lernen, vor uns hin brasseln, werden gefördert, z.B. in Grafik- und Webdesign, Print, Illustration, Foto und Video sowie Social Media, immer unter Ruhe und Rücksichtnahme, ohne Stress, können jederzeit vertrauensvoll über unsere Probleme reden, unter uns, aber auch mit den Sozialprofis, werden gehört, wenn wir einmal nicht so gut dran sind: Wenn es auf dem ersten Arbeitsmarkt so zuginge, hätte niemand ein Burnout.
Kurz: die WfbM kann ein flauschiger Rückzugsort sein für all diejenigen, die ihn vorübergehend oder auch für immer brauchen.
Es war (für mich) allerdings nicht immer schön. Begonnen habe ich in der Gärtnerei in Köln Porz. Pflanzkörbe befüllen, Böden jäten, Blumentöpfe säubern. Eine mir als Übersetzerin völlig wesensfremde Tätigkeit, die ich vielleicht zwei Monate ausgeübt habe, dann war mir klar: Hier will ich raus. Und: Ich will zurück in „das richtige Leben“. Denn zu diesem Zeitpunkt (2007) erschien mir die Werkstatt tatsächlich als ein von der Gesellschaft abgespaltener Raum.
Also suchte ich mir ein Praktikum auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dieses Praktikum wurde nach einiger Zeit in ein betriebsintegriertes Arbeitsverhältnis im Rahmen der Werkstattbeschäftigung umgewandelt und damit gaben sich alle zufrieden. Ende der Fahnenstange. Doch das „richtige Leben“ war auch das nicht, im Gegenteil, ich saß mitten im ersten Arbeitsmarkt noch immer in dem abgespaltenen Raum, war nicht Fisch, noch Fleisch.
Es folgten weitere Praktika und noch ein betriebsintegrierter Arbeitsplatz. Mein Feedback, meine Zeugnisse waren stets erlesen, ich hätte immer zu Werkstattkonditionen bleiben können, aber sozialversicherungspflichtig eingestellt wurde ich nicht: das Geld sei knapp und überhaupt wisse man nicht, wie es weiterginge mit mir. Was, wenn ich lange Zeit krank wäre, ganz ausfiele?
So vergingen die Jahre, und allmählich verspürte ich die Folgen meiner bipolaren Erkrankung, das ewige Auf und Ab, die Jahre der Depression, die starken Medikamente, den steten Wechsel der Arbeitsstellen, auch das Älterwerden, sowie meine langjährige Betreuung älterer Angehöriger. All das spürte ich auch im körperlichen Bereich.
Also wieder in die Werkstatt. Im gesamten Zeitraum, in all diesen Übergängen, war es für mich sehr beruhigend, dass ich die WfbM mit einer sehr verlässlichen, zugewandten Ansprechpartnerin im Rücken hatte.
Bei den Alexianern lernte ich noch drei Bereiche kennen: die Backstube (eine kleine süße Wohlfühloase mit einem sehr menschlichen „Patron“), die EDV-Abteilung mit ebenfalls sehr zugewandten Gruppenleitern und schließlich das Office, in welchem ich nun bis zu meiner Verrentung bleiben werde.
Zwischenstand:
- ich konnte im gesamten Zeitraum viele unterschiedliche Arbeitsbereiche kennenlernen, innerhalb und außerhalb der Werkstatt
- ich konnte meine Fähigkeiten anwenden und erweitern
- ich konnte viel Neues ausprobieren, vor allem in der Backstube und im Office
- ich hatte zu jeder Zeit kompetente Ansprechpartner
- ich hatte zu jeder Zeit Unterstützung beim Weg auf den ersten Arbeitsmarkt (Inklusionsassistenten)
- ich hatte in der WfbM immer einen geschützten Raum – sehr wichtig bei einer mentalen Krankheit
- ich fühlte mich in der Werkstatt sicher: Es wurde sensibel auf die Bedürfnisse von vielleicht traumatisierten oder verängstigten Teilnehmern eingegangen
- ich wurde gemäß meinen Fähigkeiten passgenau gefördert
- ich konnte mich ohne Angst oder Scheu krankmelden
- ich konnte die Arbeitszeit nach meinen Bedürfnissen reduzieren; mit entsprechenden finanziellen Einbußen, aber eben problemlos
- ich war unkündbar, mein Einkommen war klein, aber sicher
- ich konnte in der Werkstatt jederzeit vertrauensvoll über meine Probleme reden
- ich hatte (nette) Kollegen und Kolleginnen in gleicher Lage
Der Staatenausschuss der UN, der die Umsetzung der Konvention 2015 überprüfte, zeigte sich jedoch besorgt über die Lage behinderter Menschen am Arbeitsmarkt in Deutschland. Er nannte „Segregation“ (also Absonderung) als Hemmnis sowie „finanzielle Fehlanreize, die Menschen mit Behinderungen am Eintritt oder Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt hindern“ plus den Umstand, dass „Werkstätten weder auf den Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten noch diesen Übergang fördern. (…) Der Ausschuss empfiehlt (u.a.) die schrittweise Abschaffung der Werkstätten“. (Aus: Wikipedia | „Reform des Werkstattsystems“ | „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“)
Das ist eine Empfehlung, ich weiß nicht, ob sie bindend ist. Meine Werkstatt hat mich gut auf den Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt begleitet; allerdings bin ich sicher, dass Arbeitgeber des ersten Marktes nur sehr zögernd bestimmte Personengruppen einstellen werden (psychisch Erkrankte).
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAs) hat nun im Hinblick auf die Umsetzung der Konvention einen Aktionsplan vorgelegt. Ziele sollen unter anderem eine Verbesserung der individuellen Förderung, mehr Durchlässigkeit, mehr Transparenz bei der Entlohnung, sowie eine höhere Entlohnung sein. Es liegen bereits Stellungnahmen von Institutionen und Verbänden vor, darunter von der Bundesarbeitsgemeinschaft WfbM. Man darf gespannt sein.
Im Wikipedia-Eintrag „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, den ich weitgehend als Quelle verwendet habe, habe ich noch dieses schöne Zitat von Wolfgang Rhein gefunden:
„Arbeitende Menschen mit Behinderung außerhalb des allgemeinen Arbeitsmarktes lehren, Arbeit und Einkommen zu unterscheiden. Sie zeigen, dass Arbeit sinnerfüllt, befriedigend, zwischenmenschlich bereichernd, gesellschaftlich wertvoll sein kann, ohne dem vermeintlichen Hauptzweck, dem Einkommenserwerb, gewidmet zu sein. Sie stehen für die Entwicklung einer Kultur, in der gesellschaftlich wertvolle Arbeit abseits des Erwerbs und gesellschaftlich wertvolle Beiträge abseits von Arbeit als wertvoll und bereichernd anerkannt sind, ohne dass die Beitragenden als Gescheiterte, Trittbrettfahrer, Sozialschmarotzer abgetan werden.
Sie greifen damit den noch kaum genutzten Möglichkeiten einer postindustriellen Gesellschaft voraus, für die es ungeachtet aktueller Engpässe (Fachkräftemangel) immer weniger angemessen ist, Einkommen regelhaft nur an gewohnte Formen knapper werdender (Erwerbs-)Arbeit zu binden, die dem technischen Fortschritt kontinuierlich weichen müssen.“ (Aus: Wikipedia | „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“)
Ich finde das richtig. Vielleicht sogar zukunftsweisend. Denn noch überhaupt gar nicht abzusehen ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt im Hinblick auf die KI.
Welche Menschen verrichten im Jahr 2040 welche Arbeit wo? Und wird man all die schönen Überlegungen aus dem Aktionsplan bei angespannter Haushaltslage überhaupt durchsetzen können?
Welche Alternativen hätten wir, wenn die Werkstätten, sagen wir einmal im wohlwollenden Übereifer, tatsächlich abgeschafft würden? Säßen wir dann in der Wohnung herum, mit Bürgergeld oder einer schmalen Rente? Oder im sozialpsychiatrischen Zentrum, den ganzen Tag Kaffee trinkend? Kann man Arbeitgeber verpflichten, unsereinen einzustellen?
Fazit:
- Ich wünsche mir dringend einen Wechsel von der überbehütenden Fürsorgehaltung hin zu einer echten Gleichberechtigung. Vor allem bei denjenigen, die mich aus der WfbM hinaus (oder auch hinein) fördern wollen, weil das besser für mich sei.
- Ich wünsche mir entsprechende Rahmenbedingungen für all diejenigen, die die Werkstatt verlassen wollen.
- Ich wünsche mir entsprechende Rahmenbedingungen, für all diejenigen, die das nicht möchten.
Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass diejenigen, die über all das entscheiden, wir sind, die behinderten Menschen, die wir das Werkstattleben aus unserer Perspektive kennen.
Ein Beitrag von Cornelia Schmitz
Titelbild von Barbara Minnich | AlexOffice
Quellen und weiterführende Links:
• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): „Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention“
• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ): „Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (barrierefreies PDF)“
• Wikipedia: „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“
• Wikipedia: „Werkstatt für behinderte Menschen“
• Wikipedia: „Reform des Werkstattsystems“
• Deutsches Institut für Menschenrechte: „Rechte von Menschen mit Behinderungen | Arbeit“
• Xblog-Artikel „Werkstatt weiterdenken“ von Cornelia Schmitz
Auch du kannst deinen Text, deine Erfahrung, dein Gedicht oder auch deinen Podcast bei uns einreichen. Unter Kontakt findest du unsere Ansprechpartner. Schick uns dein Werk und wir veröffentlichen es.

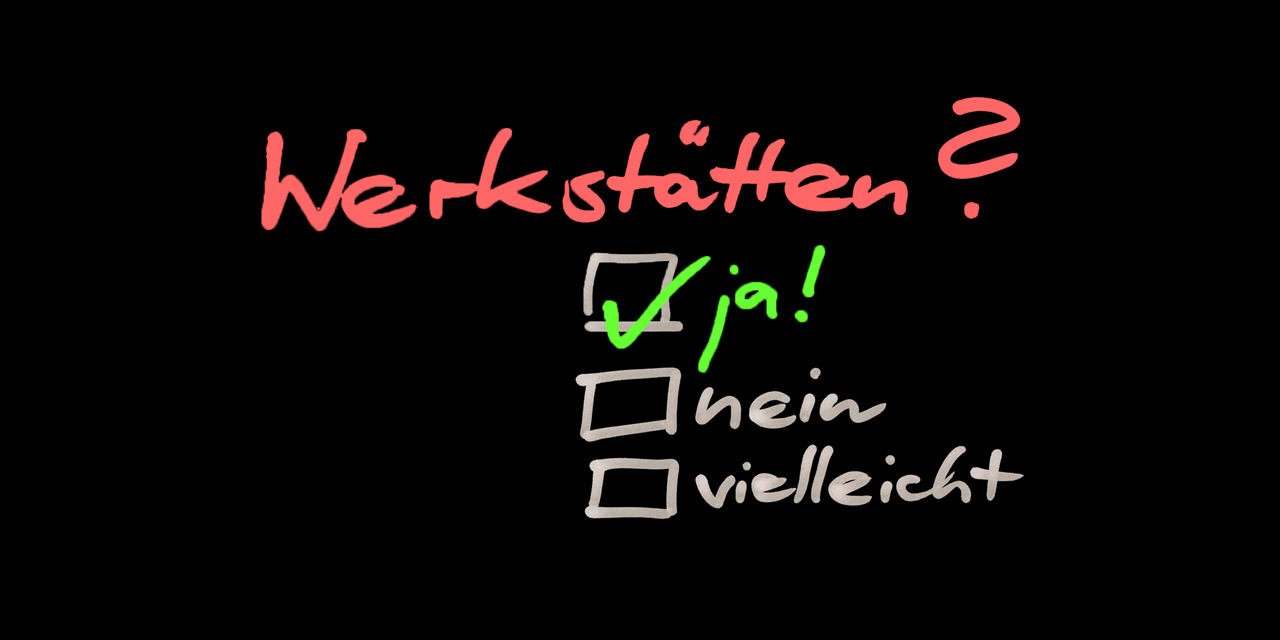


DANKE für deinen schönen Artikel! 🙂
Liebe „Conny“,
Danke für den SEHR wichtigen Beitrag!!!! Leider erst spät gelesen…
LG & schöne Weihnachten;* j.
Danke euch beiden für die Kommentare.