Nach ihrem Xblog-Beitrag »Werkstatt weiterdenken« im letzten Jahr befasst sich Cornelia Schmitz (AlexOffice) in ihrem neuen Artikel »Armut in der WfbM« (Werkstatt für behinderte Menschen) wieder mit dem großen Thema Inklusion. Der Kerngedanke ist: Werkstätten müssen den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt wesentlich mehr fördern. Angefangen bei der Gestaltung von Förderschulen bis hin zur Realität in Werkstätten geht’s in diesem Zusammenhang schließlich um’s Geld – um den Werkstattlohn, den Cornelia hier im Speziellen erörtert und dazu auch die Forderungen des Bundesvorstandes der Werkstatträte zitiert.
Armut in der WfbM
Jan Böhmermann, der Moderator des ZDF-Magazins Royale, polarisiert gerne.
Vor kurzem hat sich der Journalist Jan Böhmermann im ZDF-Magazin Royale dem Thema Inklusion angenommen. Er beklagte, dass Deutschland ein exkludierendes Land sei, siehe Barrierefreiheit, Reisefreiheit, Zugang zu öffentlichen Einrichtungen u.v.m.
In all diesen Punkten bin ich voll seiner Meinung; hier muss noch sehr viel getan werden. Natürlich auch im Hinblick auf barrierefreies Wählen.
Bei Einrichtungen wie Förderschulen oder Werkstätten für behinderte Menschen hat er allerdings nicht so ganz ins Schwarze getroffen.
Fangen wir bei den Förderschulen an:
Ja, Inklusion ist wichtig und richtig. Es wäre gut, wenn wir Schulen hätten, in denen Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernten und spielten, damit sie sich kennenlernten und Vorurteile abbauten. Dann allerdings aber auch mit entsprechender Ausstattung, sowohl was die Räumlichkeiten wie auch das Personal angeht: Kleine Klassengröße, mehr Schulbegleiter, Barrierefreiheit, all das.
Das alles ist jedoch nicht der Fall. Denn die Politik wollte dieses ungemein wichtige Ziel ruckzuck durchsetzen, schloss also die Förderschulen und warf die Kinder in die Regelschule. Dies eine Aktion, unter der ALLE Kinder leiden, behindert oder nicht. Kinder, Eltern und Lehrer sind frustriert, weil das so wichtige Ziel nicht nur nicht erreicht wurde, sondern sich sogar ins Gegenteil verkehrte: Man sah die Kinder mit Beeinträchtigungen nun eher kritisch. Zahlreiche Eltern melden ihr behindertes Kind wieder in einer Förderschule an, weil sie dachten, dort würde der kleine Mensch tatsächlich besser gefördert.
Statt also besonnen an das Thema heranzugehen und die Inklusion langsam, Stück für Stück, umzusetzen, hatte man den letzten Schritt vor dem ersten getan.
Ein ähnlich kurzsichtiger Umgang ist seit geraumer Zeit auch mit den WfbM zu beobachten. Sie seien exkludierend und ausbeutend. So wird das vielfach diskutiert und in dieses Horn blies jetzt auch Jan Böhmermann mit einem recht verkürzten Blick auf die Wirtschaftlichkeit der Werkstatt: Fiese Konzerne beuteten die armen behinderten Menschen aus, einzig des Profites wegen. Damit sich FDP-Mann Lindner günstig Porsches kaufen kann. Und wir, die Beschäftigten, seien dem hilflos ausgeliefert.
Sicher ist eines: Die Werkstätten müssen mehr Menschen in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Aktuell reden wir von 0,6 Prozent. Das ist die Vermittlungsquote und die ist viel zu niedrig. Die Werkstätten müssen so sein, dass der Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt gelingt, und zwar nicht nur im Niedrig-Lohn-Sektor.
Wie verhält es sich aber mit unserem Lohn? Was ist dran an der Ausbeuterei? Werden wir ausgenutzt? Was ist mit dem Mindestlohn, muss der uns nicht gezahlt werden? Haben wir Alternativen zur Werkstatt? Und vor allem: Was sagt unsere Interessensvertretung, die Bundesvereinigung der Werkstatträte zu all diesen Fragen?
Fangen wir mit dem Konstrukt Werkstatt an:
1. Eine Beschäftigung in einer WfbM ist freiwillig. Kann mit Sechs-Wochen-Frist gekündigt werden. Jede/r kann sich jederzeit eine andere Arbeit suchen, vielleicht mit dem Instrument des persönlichen Budgets. Es wird komischerweise immer so getan, als unterläge man als behinderter Mensch irgendwie einer Verpflichtung zur WfbM; das ist aber nicht der Fall. Wer nicht in der Werkstatt ist (oder sonst wo arbeitet), sitzt dann eben mit seinem Bürgergeld oder der Rente zuhause. Oder geht vielleicht in eine Tagesstätte.
2. Das Arbeitsverhältnis ist arbeitnehmerähnlich. Es handelt sich um eine Hilfe zur Teilhabe an der Arbeit.
Welche Konsequenzen hat das für den einzelnen Beschäftigten?
Nun, er oder sie ist eingebettet in ein System, in dem im Idealfall größtmöglich auf den beeinträchtigten Menschen eingegangen wird, ein System mit einem Sozialen Dienst, begleitenden Angeboten wie Sport oder Computerkursen, mit einer Arbeit, die ihm im Idealfall dient.
In meiner Werkstatt erfüllen wir (Menschen mit psychischen Erkrankungen) komplexe und schwierige Aufgaben (für die wir anderenorts viel Geld bekämen, aber dazu später). Jederzeit kann man sein Pensum steigern oder verringern, jederzeit kann man Gruppenleiter ansprechen, auch im Hinblick auf Themen, die außerhalb der Arbeit liegen. Jederzeit kann man den Ruheraum oder den Kreativraum aufsuchen, das machen auch viele, wenn sie etwa gestresst sind. Kann sich das jemand für den ersten Arbeitsmarkt vorstellen?
Überhaupt sind die Beschäftigten wenig Arbeitsdruck ausgesetzt; die Arbeit soll ihnen nämlich dienen und sie aufbauen und sie gerade nicht unter Druck setzen. Nochmal: kann sich das jemand für den druckvollen ersten Arbeitsmarkt vorstellen?
Viele freuen sich auf einen Ort der Begegnung, auf eine sinnvolle Betätigung, eine Tagesstruktur.
Kommen wir nun zum Lohn, dem Werkstattentgelt, dem Casus Knacksus.
Böhmermann prangerte plakativ den Stundenlohn an, der bei rund zwei Euro läge, was eine unerhörte Frechheit sei, quasi Sklaverei.
Diese erschreckende Zahl wird aus Gründen gern mal in den Raum geworfen, und steht dann da wie ein fahler Reiter.
Was oft vergessen wird: Die Beschäftigten erhalten zum Arbeitsentgelt entweder EU-Rente oder Bürgergeld (beim Bürgergeld wird der Arbeitslohn anteilig angerechnet).
Dazu kommen: Wohngeld, ein Jobticket, ein kostenloses Mittagessen (für die Bezieher von Bürgergeld), Fortbildungsmöglichkeiten und, last, but not least, eine Einzahlung in die gesetzliche Altersrente.
Zudem haben manche einen Betreuer, der ihnen bei vielen Fragen zur Seite steht und/ oder einen Pflegegrad, der helfende Mitarbeiter ermöglicht.
Schauen wir uns dagegen den Mindestlohn an; dies auch so eine Zahl im Raum. Werkstatt-Beschäftigte müssten den Mindestlohn erhalten, das sei zwingend, heißt es.
Der Mindestlohn (bei einer 40 Std. Woche, wohlgemerkt) liegt aktuell bei ca. 2.100€ brutto. Ein alleinstehender Mensch kommt netto bei etwa 1.500€ raus. Davon könnte man in Köln keine Wohnung finanzieren und wenn doch, bliebe kaum genug fürs Essen.
Der Mindestlohn ist also zu niedrig, gar keine Frage.
Aber wäre es gerecht gegenüber all den Paketboten, Kassierern, Küchengehilfen, mit ihrem schweren Arbeitsalltag, wenn wir, die Beschäftigten, den gleichen Lohn bezögen wie sie? Obwohl wir lange nicht dasselbe Stundenpensum, wenig bis keinen Leistungsdruck und viel mehr Hilfestellung haben?
Natürlich bin ich nicht gegen mehr Geld für mich, ich bin ja nicht blöd, aber das Verhältnis von Mindestlohn-Entlohnten zu Werkstatt-Entlohnten muss sich aus meiner Sicht in einer fairen Relation bewegen.
Eines bleibt – darauf hat Böhmermann zu Recht aufmerksam gemacht und man kann es nicht weg reden: Mit einer Werkstattbeschäftigung (übrigens auch mit dem Mindestlohn) geht im schlimmsten Fall lebenslange Armut einher, ob in der WfbM-Tätigkeit oder auch später in der Rente: man hat zwar ein geschütztes Arbeitsleben, kommt aber finanziell auf keinen grünen Zweig, bleibt lebenslänglich auf soziale Wohltaten angewiesen.
Was sagt unsere Interessensvertretung, der Bundesvorstand der Werkstatträte, zur Frage des Lohns?
Der sagt:
Wir fordern als Sofort-Maßnahme der neuen Bundes-Regierung:
- Einen staatlich finanzierten Lohn-Baustein im Werkstatt-Lohn. Dieser sollte mindestens 200 Euro betragen.
- Der gesamte Werkstatt-Lohn muss frei von der Anrechnung auf Grundsicherung werden.
Wir fordern mittelfristig:
- Einen guten und auskömmlichen Lohn für alle Werkstatt-Beschäftigten, der frei von Armut und Grund-Sicherung macht.
- Der Lohn muss überwiegend steuerfinanziert werden. Ein guter Lohn kann von Beschäftigten in Werkstätten nicht allein erwirtschaftet werden.
- Das Lohn-System muss einfach und leicht zu verstehen sein.
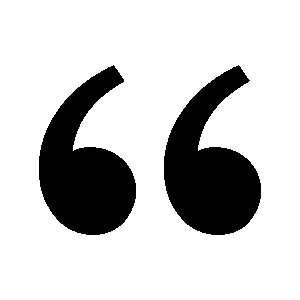
Das sind leicht nachvollziehbare und glasklare Forderungen.
Doch was geschieht, wenn sowohl Mindestlohn und entsprechend Werkstattlohn substanziell angehoben würden? Werden dann nicht die Firmen mal eben den Standort verlagern? Nach Rumänien, Kroatien, überall dahin, wo die Löhne am niedrigsten sind? Glaube schon. Das ist voll gemein, aber Tatsache. Und ich weiß nicht, wo man da den Hebel ansetzen kann; gerne würde ich mich einer diesbezüglichen Fragerunde anschließen.
Wie eingangs gesagt:
Die Werkstätten müssen sich verändern und wesentlich mehr in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse vermitteln.
An anderer Stelle habe ich bereits beschrieben, wie das gelingen kann:
 Werkstatt weiterdenken – Xblog der Alexianer Werkstätten GmbH
Werkstatt weiterdenken – Xblog der Alexianer Werkstätten GmbH
Nun, liebes ZDF, liebes Magazin Royale:
Ihr beschäftigt nach eigenen Angaben niemand mit einer Schwerbehinderung? Da kann ich helfen. Ich kann bestimmt Kollegen/ Kolleginnen vermitteln (alle mit einer Diagnose aus dem Bereich psychische Erkrankung, alle aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit; in meiner WfbM programmieren wir, wir machen Webdesign, wir bloggen und podcasten und haben einige Akademiker im Angebot).
Wäre das nix für euch?
Dieser Text wurde von einem unserer Werkstatträte, Herrn Udo Prinz, gegengelesen und für sachlich richtig befunden.
Ein Beitrag von Cornelia Schmitz
Bilder:
• Titelfoto (Ausschnitt) von Alicia Christin Gerald auf Unsplash
• Quote icons created by Icon Mela – Flaticon
Auch du kannst deinen Text, deine Erfahrung, dein Gedicht oder auch deinen Podcast bei uns einreichen. Unter Kontakt findest du unsere Ansprechpartner. Schick uns dein Werk und wir veröffentlichen es.



